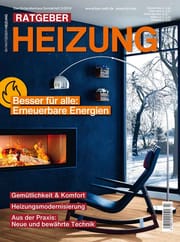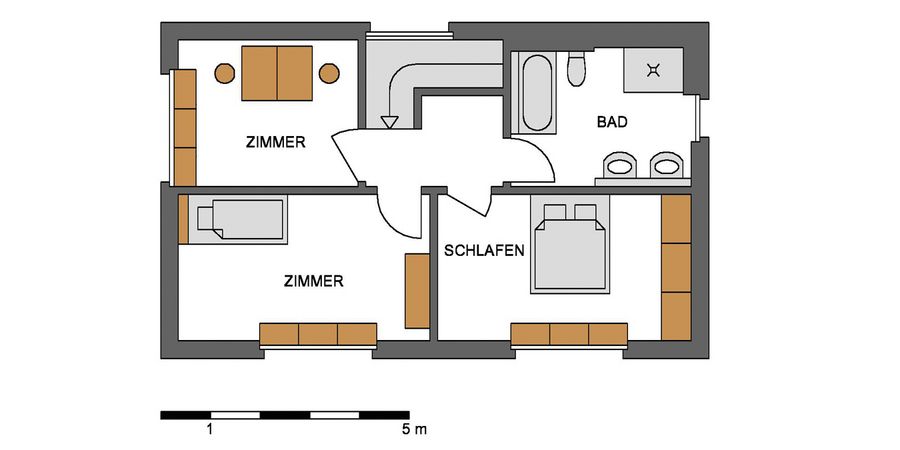Der Grundriss ist ein wichtiger Teil der Hausplanung. Er bestimmt Größe und Anordnung der Räume. Ein Grundriss beeinflusst, wie gut es sich in einem Haus wohnen lässt. Bei der Raumplanung müssen die Gewohnheiten und Bedürfnisse der Bewohner berücksichtigt sein. Hier finden Sie beispielhafte Grundrisse für jedes Haus, sicher auch den richtigen für Ihren Hausbau.
Bauteile
Mit Wintergarten die Sonne einfangen
Ein Wintergarten schafft ganzjährig zusätzlichen Wohnraum – vorausgesetzt, er ist richtig…
Keller: Wohnfläche plus Stauraum
Ein Keller bietet viele Nutzungsmöglichkeiten – nicht nur für die Haustechnik, sondern auch als…
Der erste Eindruck: Fassade
Die Möglichkeiten der Fassadengestaltung sind vielfältig. Die Fassade prägt das Erscheinungsbild des…
Modern und sicher: Haustüren
Moderne Haustüren vereinen Design und Sicherheit. Wir zeigen die wichtigsten Merkmale.
Mehr Durchblick: Fenster
Vom Loch in der Wand zum multifunktionalen Wohlfühlspender – Fenster sind zentrale Bauteile für ein…
Beliebte Dachformen
Pultdach, Flachdach oder Satteldach? Wir geben einen Überblick über die beliebtesten Dachformen.